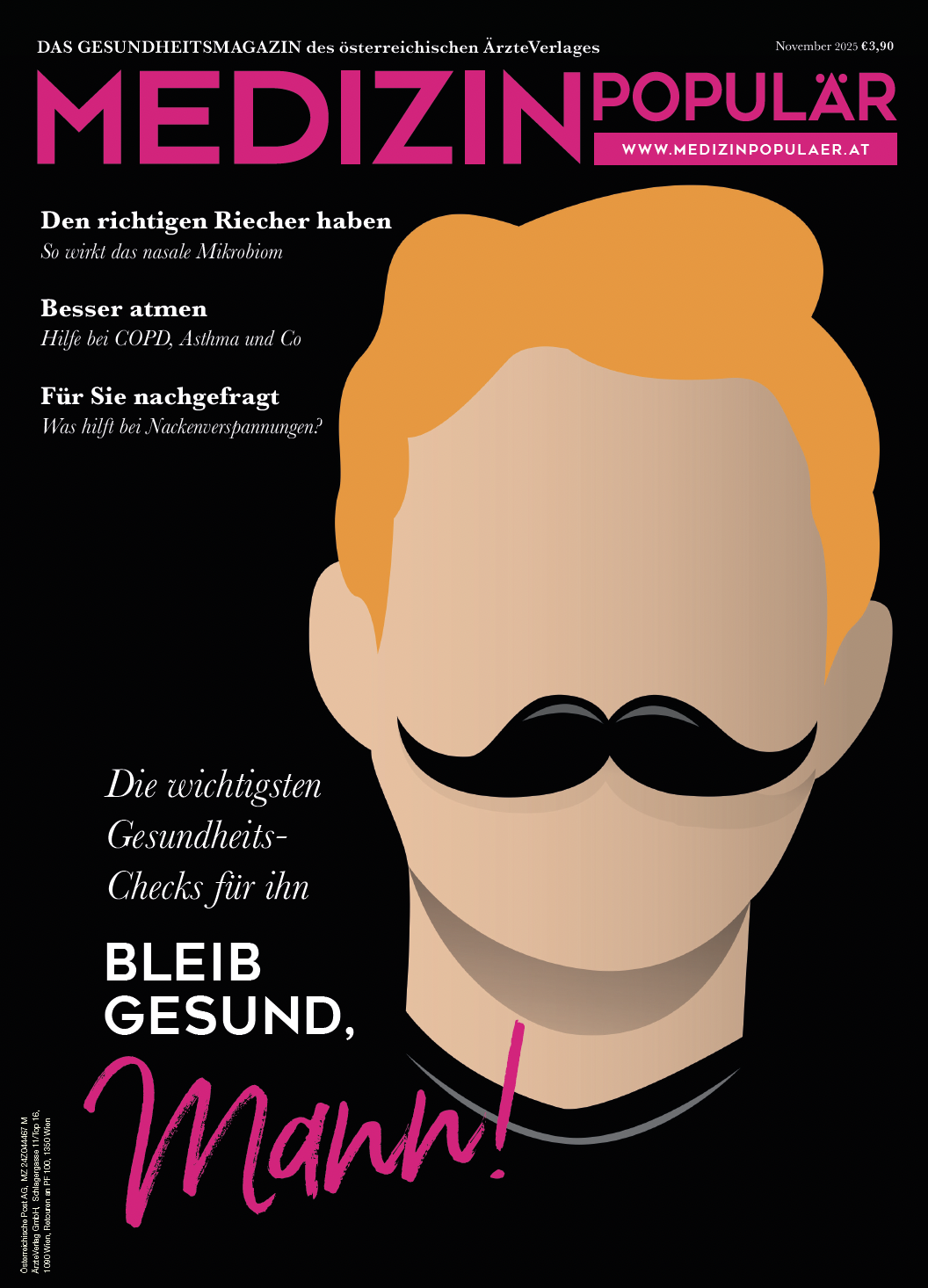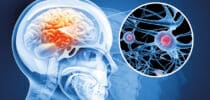Die Kompressionstherapie gehört zu den ältesten und zugleich wirksamsten Methoden in der Behandlung von Venenerkrankungen. Bereits Hippokrates beschrieb im Jahr 400 vor Christus das Prinzip, mit Druck von außen Beschwerden der Venen, Beingeschwüre oder eine Veneninsuffizienz zu behandeln. Bis heute gilt die Kompression als unverzichtbare konservative Therapieform – besonders bei der chronischen Veneninsuffizienz.
Wie wirkt die Kompressionstherapie?
Die Wirksamkeit hängt vor allem vom Druck und von der Elastizität des Materials ab. Der Druck von außen verbessert die Mikrozirkulation und wirkt positiv auf die großen Venen, deren Klappen geschädigt sind. Dadurch verringern sich Ödeme, die Beine fühlen sich leichter an, und die Heilung von Geschwüren (Ulcera) wird unterstützt.
- Kurzzugverbände bilden eine feste Manschette, die der Wadenmuskulatur Widerstand bietet. Beim Gehen oder Bewegen wirkt die Muskelpumpe so effektiver, Flüssigkeit wird aus dem Gewebe abtransportiert.
- Der Arbeitsdruck ist hoch, der Ruhedruck vergleichsweise niedrig – daher können diese Verbände auch nachts getragen werden.
- Das Anlegen muss jedoch sorgfältig erlernt werden, um Komplikationen wie Schnürfurchen oder im schlimmsten Fall Nekrosen zu vermeiden.
Langzugbandagen sind einfacher anzulegen, aber weniger wirksam, da sie der Muskulatur weniger Widerstand bieten. Zudem sind sie nachts oft unangenehm, weshalb sie täglich neu angelegt werden müssen.
Kompressionstherapie bei fortgeschrittener Veneninsuffizienz
In den Spätstadien, besonders beim Ulcus cruris venosum (offenes Bein), ist eine exakte Kompressionstherapie entscheidend.
- Studien belegen: Unter konsequenter Kompressionstherapie heilen rund 70 % der kleineren Ulzera (<10 cm², <3 Monate Dauer) innerhalb von zwölf Wochen ab.
- Ulzera im Bereich des Innenknöchels (retromalleolär) sind besonders hartnäckig. Hier sind häufig zusätzliche Schaumgummi-Pelotten notwendig, um ausreichend Druck aufzubauen.
- Viele Fachleute bevorzugen in der Heilungsphase unelastische Materialien, etwa Zinkleim- oder Fischerverbände, die eine bessere hämodynamische Wirkung haben.
Wundauflagen – was ist sinnvoll?
Parallel zur Kompression werden Wundauflagen eingesetzt. Die ideale Auflage sollte Sekret aufnehmen, nicht verkleben und keine Allergien auslösen. Bisher gibt es jedoch nur wenige hochwertige Studien, die eine Überlegenheit spezieller Materialien eindeutig belegen.
Rückfälle vermeiden – Dauerkompression als Schlüssel
Die eigentliche Herausforderung ist weniger die Heilung als das Verhindern von Rückfällen. Rund 30 % der Ulzera treten erneut auf. Deshalb empfehlen Fachgesellschaften nach der Abheilung eine dauerhafte Kompression mit medizinischen Kompressionsstrümpfen (Klassen II–III).
Besondere Situationen: arterielle Durchblutungsstörungen
Bei etwa 10 % der Patientinnen und Patienten liegt die Ursache eines Beingeschwürs nicht im Venensystem, sondern in einer arteriellen Durchblutungsstörung. Hier sind feste Verbände kontraindiziert, da sie die Blutzufuhr zusätzlich behindern könnten. Vor Beginn jeder Kompressionstherapie ist daher eine Doppler-Ultraschalluntersuchung zur Abklärung notwendig.
Bei gemischten Ulzera (venös + arteriell) kann eine modifizierte, druckarme Kompression sinnvoll sein. Speziell unelastische Materialien wirken hier wie eine Massage: Mit jedem Schritt werden Ödeme reduziert, gleichzeitig verbessert sich die arterielle Durchblutung.
Duplex-Ultraschall – Grundlage für die richtige Therapie
Früher galt das venöse Ulkus als typische Folge eines postthrombotischen Syndroms mit Schädigung der tiefen Venen. Heute wissen wir: Bei mehr als der Hälfte der Patientinnen und Patienten ist nur das oberflächliche Venensystem betroffen.
Mit einer Duplex-Ultraschalluntersuchung lässt sich nicht nur die venöse Ursache nachweisen und die arterielle Situation abklären, sondern auch entscheiden, wer von einer zusätzlichen Therapie profitiert.
Neben der Kompression können oberflächliche Refluxe auch durch Operationen oder minimalinvasive Verfahren wie die ultraschallgesteuerte Schaumsklerosierung behandelt werden – ambulant, ohne Narkose, auch für ältere Patientinnen und Patienten geeignet.
Fotos: istock Pikovit44