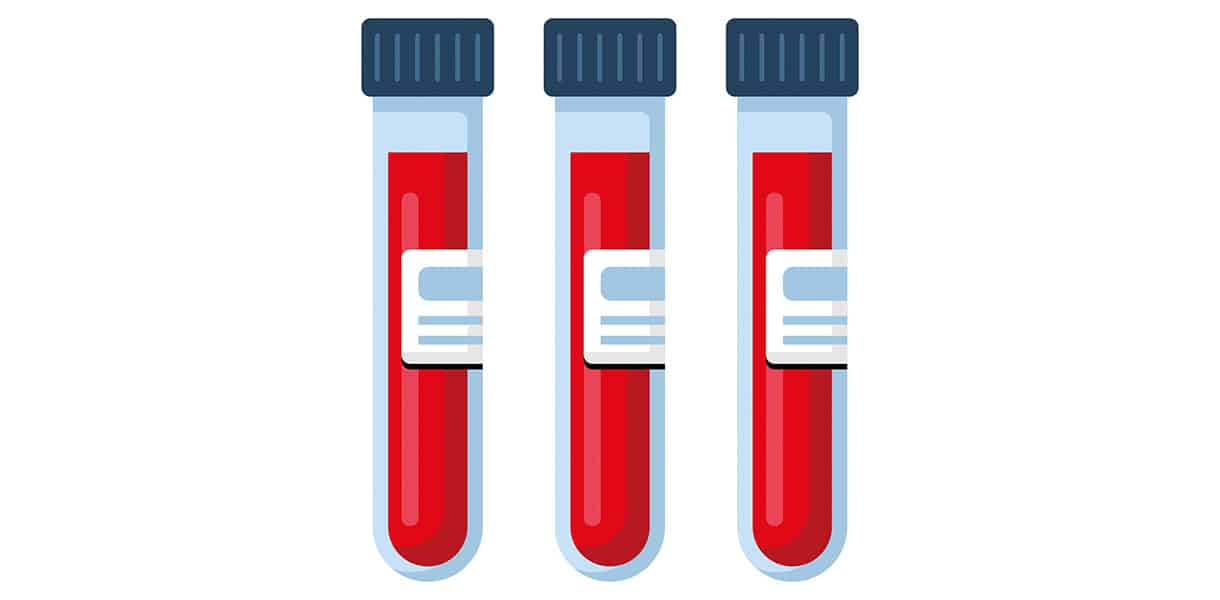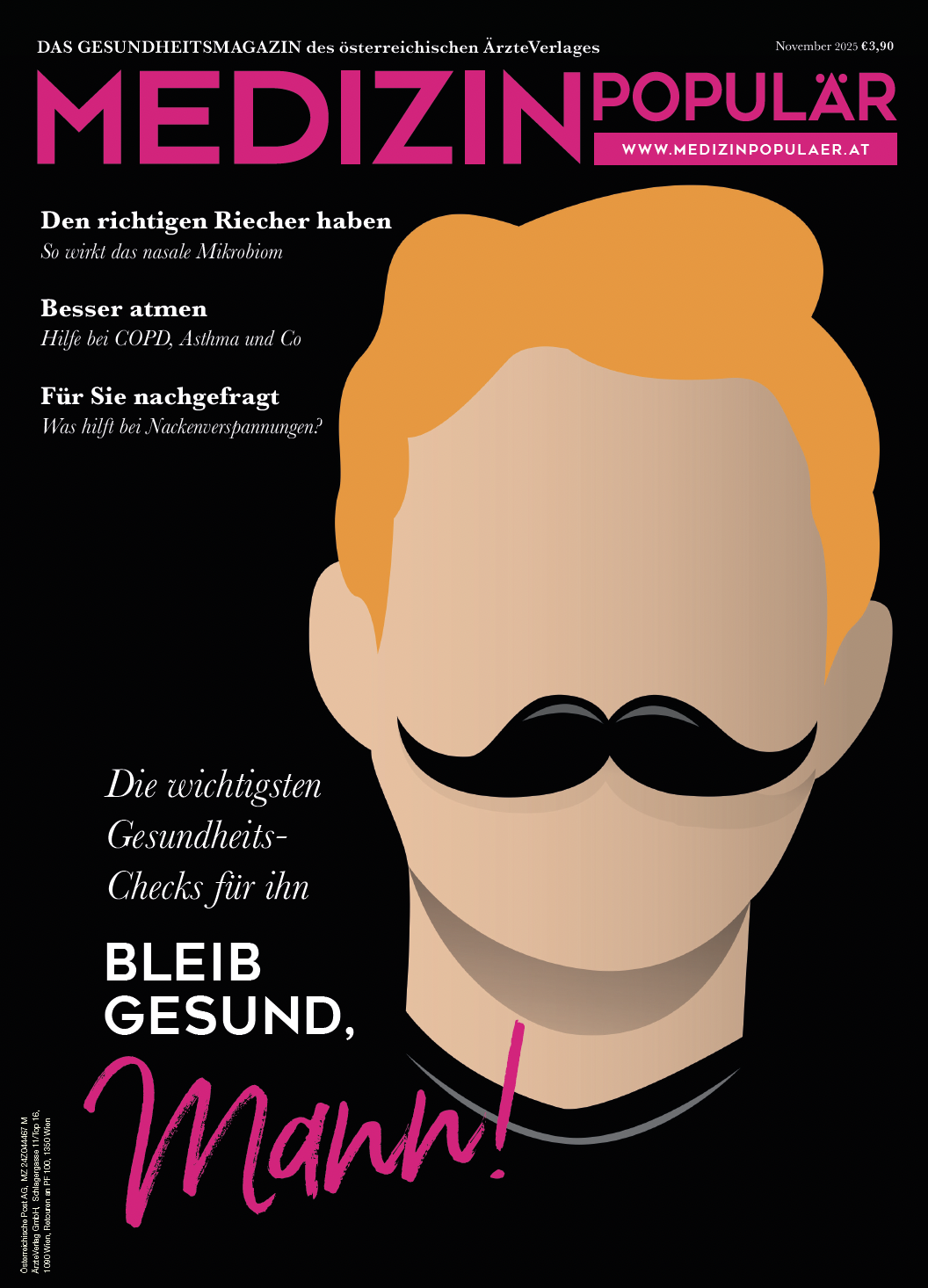Ein Forschungsteam der MedUni Wien hat einen neuartigen Bluttest entwickelt, der das Risiko für Multiple Sklerose (MS) bereits Jahre vor den ersten Krankheitszeichen aufzeigen kann. Damit eröffnet sich die Chance, Diagnose und Therapie so früh einzuleiten, dass der Ausbruch der Erkrankung hinausgezögert oder sogar verhindert werden könnte. Veröffentlicht wurden die Ergebnisse nun im Fachjournal Nature Communications.
Wie der Test funktioniert
Entwickelt wurde die Methode von Teams um Elisabeth Puchhammer-Stöckl und Hannes Vietzen vom Zentrum für Virologie sowie Thomas Berger und Paulus Rommer von der Universitätsklinik für Neurologie. Grundlage ist ein immunologisches Verfahren, das Antikörper gegen ein Protein des Epstein-Barr-Virus (EBV) nachweist. Fast alle MS-Betroffenen hatten zuvor eine EBV-Infektion durchgemacht. Der Test identifiziert Autoantikörper gegen einen Abschnitt des Proteins EBNA-1, die oft bereits drei Jahre nach einer Infektion auftreten – lange bevor Symptome sichtbar werden.
Hohe Trefferquote
„Werden diese Antikörper mehrfach nachgewiesen, ist die Wahrscheinlichkeit für eine spätere MS sehr hoch“, erklärt Erstautor Hannes Vietzen. Basis der Studie waren Blutproben von mehr als 700 MS-Patientinnen und -patienten und 5000 Kontrollpersonen. In Teilen der Kohorte ließ sich sogar der Zeitpunkt der EBV-Erstinfektion nachvollziehen – dabei zeigte sich, dass hohe, konstante Antikörperspiegel eng mit einem schnellen Krankheitsbeginn verbunden waren.
MS immunologisch vorhersagbar
Multiple Sklerose ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems, von der weltweit rund 2,8 Millionen Menschen betroffen sind. Sie entsteht durch fehlgeleitete Immunreaktionen, oft getriggert durch EBV. Andere Marker für Nervenschädigungen steigen erst später an, was den neuen Test besonders wertvoll macht.
Blick in die Zukunft
„Unsere Arbeit belegt, dass MS schon lange vor dem Auftreten von Symptomen immunologisch erkennbar ist“, betont Puchhammer-Stöckl. Künftig könnte der Test gezielt bei Risikogruppen eingesetzt werden, etwa nach Pfeiffer’schem Drüsenfieber. „So wäre es möglich, Therapien so früh zu beginnen, dass der Krankheitsausbruch verzögert oder verhindert wird“, ergänzt Paulus Rommer. Thomas Berger sieht bereits Potenzial für Screening-Programme – betont aber, dass vor einer klinischen Anwendung weitere Studien nötig sind.
Fotos: istock Thomthong Ardhan