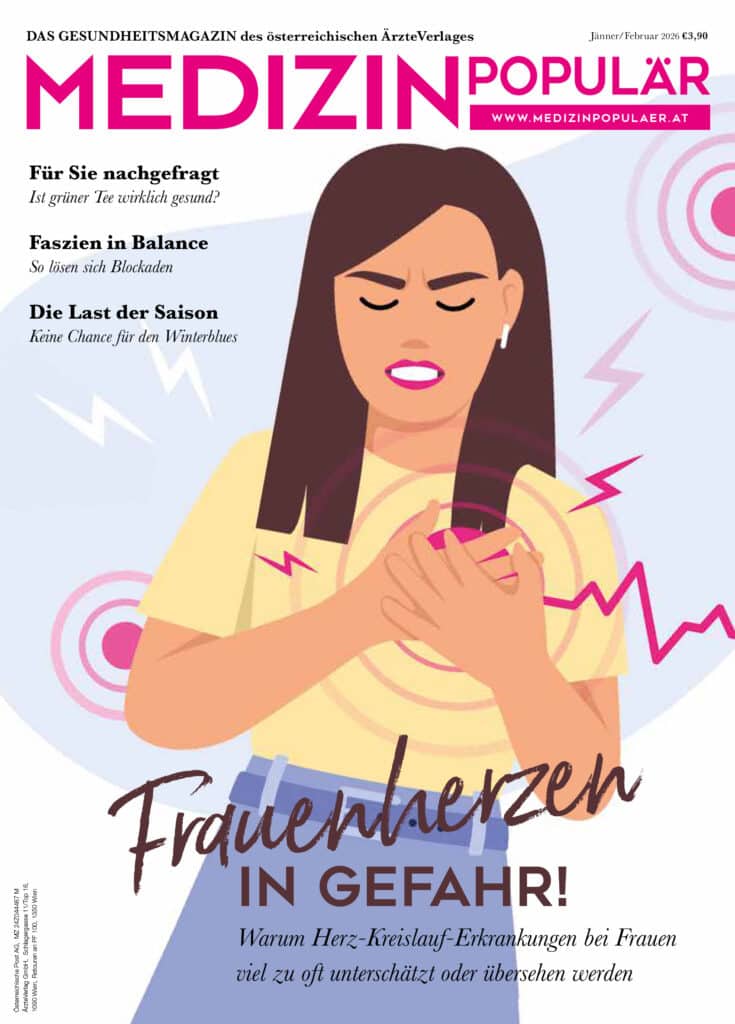Kribbeln, Schmerzen, Taubheit – Polyneuropathie trifft rund zehn Prozent der Bevölkerung. Was hinter dem Nervenleiden steckt, welche Therapien helfen und wie Betroffene ihren Alltag besser meistern können.
Von Natascha Gazzari

„Grundsätzlich kann
jede Person an einer Polyneuro-pathie erkranken, es gibt aber bestimmte Risikofaktoren.“
Der Krebs ist überstanden, die Wunden der Tumoroperation sind verheilt und die Rückkehr in den Job ist gelungen. Drei Jahre nach seiner Speiseröhrenkrebs-Diagnose steht Karl-Heinz (59) wieder mitten im Leben – und doch wird er bei jedem Schritt an die Krankheit und die Chemotherapie erinnert. Seit der Behandlung leidet Karl-Heinz an einer Polyneuropathie in den Füßen. „Es ist ein Gefühl, als ob die Füße Tag und Nacht eingeschlafen wären. Dazu kommen teilweise starke, brennende Schmerzen und Krämpfe“, berichtet der Versicherungsmakler. Auch Wetter und Tagesverfassung scheinen die Beschwerden zu beeinflussen: „Dann fühlt es sich an, als hätte man zu viel getrunken und der Stand wird unsicher.“ Sein gewohntes Schuhwerk hat Karl-Heinz durch Barfußschuhe ersetzt und wann immer es möglich ist, geht er barfuß, um den Kontakt zum unterschiedlichen Untergrund zu spüren. Therapie steht täglich auf dem Programm: „Ich starte mit Wechselbädern in den Tag, arbeite mit einem Durchblutungsstimulator und mache Übungen mit dem Noppenball.“ Regelmäßige Physio- und Ergotherapie sowie Zellenbäder sollen helfen, die Beschwerden in den Griff zu bekommen. „Polyneuropathie ist nicht lustig!“, bringt es Karl-Heinz auf den Punkt, der sich trotz der Einschränkungen durch die Krankheit seinen Optimismus bewahrt hat. Denn, so der Oberösterreicher: „Aufgeben tut man einen Brief!“
So wie Karl-Heinz geht es vielen Krebspatientinnen und -patienten, zählt Polyneuropathie (PNP) doch zu einer der häufigsten Nebenwirkungen einer Chemotherapie. Die Medikamente, die bei einer Chemotherapie zum Einsatz kommen, schädigen nicht nur Tumorzellen, sondern verteilen sich im ganzen Körper. Einige Wirkstoffe, die vor allem bei Darm-, Brust-, Lungen-, Knochenmark- und Blutkrebs eingesetzt werden, greifen auch Nervenzellen an.

„Bei Polyneuropathie
werden Therapieansätze aus unterschiedlichen Fachbereichen kombiniert.“
Wie kommt es zu einer Polyneuropathie?
„Polyneuropathie ist ein Sammelbegriff für Erkrankungen unterschiedlicher Ursachen, die die Nerven außerhalb von Gehirn und Rückenmark betreffen“, erklärt Priv.-Doz. Dr. Martin Krenn, PhD, von der Universitätsklinik für Neurologie der Medizinischen Universität Wien. „Poly“ beschreibt dabei, dass mehrere Nerven gleichzeitig betroffen sind, und „Neuropathie“ bezeichnet die Nervenschädigung. Die betroffenen Nerven können zum Beispiel für Empfindungen, aber auch für motorische Funktionen verantwortlich sein und leiten Signale zwischen Gehirn und Körper weiter. Durch die Nervenschädigung funktioniert die Signalweiterleitung nicht richtig, was dann zu Beschwerden führt. „Typische Beschwerden sind Kribbeln, Taubheit sowie brennende oder stechende Schmerzen, die meist in den Füßen beginnen. Darüber hinaus kann es zu einer Muskelschwäche und Gleichgewichtsproblemen kommen, was von manchen Betroffenen auch als Schwindel wahrgenommen wird“, berichtet der Mediziner. Im weiteren Krankheitsverlauf kann die Polyneuropathie auch auf die Hände übergehen. Bemerkbar macht sich die Erkrankung dann etwa durch Probleme beim Zuknöpfen oder Schreiben. Auch sogenannte „vegetative Symptome“ wie Verdauungsstörungen, Schwindel beim Aufstehen, vermehrtes oder vermindertes Schwitzen, Problemen beim Wasserlassen oder Erektionsstörungen, können laut Krenn auftreten. „Solche Symptome werden oft nicht sofort mit einer Polyneuropathie in Verbindung gebracht, können jedoch wichtige Hinweise liefern“, ergänzt der Neurologe.
Wer ist betroffen?
„Grundsätzlich kann jede Person an einer Polyneuropathie erkranken, es gibt jedoch bestimmte Risikofaktoren wie Diabetes mellitus, übermäßiger Alkoholkonsum, Vitaminmangel – besonders Vitamin B12 –, chronische Nieren- oder Lebererkrankungen sowie bestimmte Medikamente wie Chemotherapien“, berichtet Krenn. In seltenen Fällen handelt es sich bei Polyneuropathien um rein genetische Erkrankungen, die vererbt werden.
Welche Therapien helfen?
„Die Therapie der Polyneuropathie ist grundsätzlich multimodal, beginnt aber – wo dies möglich ist – mit der Behandlung der Ursache“, erklärt Univ.-Prof. Dr. Richard Crevenna, MBA, MSc, MSc, Vorstand der Universitätsklinik für Physikalische Medizin, Rehabilitation und Arbeitsmedizin an der Medizinischen Universität Wien. Neben der Ursachenbehandlung – etwa der Behebung eines Vitaminmangels, einer guten Diabeteseinstellung, Alkoholkarenz etc. – kommen konservative medikamentöse Therapien, etwa in Form von Antidepressiva, Antikonvulsiva, selten auch Opioide, sowie die Wirkstoffe Capsaicin und Lidocain als oberflächliche Anwendung zum Einsatz. Auch nicht-medikamentöse Therapieformen, die psychologische und soziale Betreuung sowie die Fußpflege und das Tragen von Einlagen- bzw. speziellen Schuhen (z. B. bei diabetischem Fußsyndrom) sind wichtige Bausteine. „Die Diagnostik und die Therapie müssen leitliniengerecht erfolgen und in ein multimodales Behandlungsschema eingebettet sein, wobei eine individuelle Verordnung und Rezeptur am erfolgversprechendsten zu sein scheint“, ergänzt Crevenna.
Lässt sich eine Polyneuropathie vorbeugen?
Nicht gegen jede Form der Polyneuropathie können vorbeugende Maßnahmen getroffen werden. Allerdings wirkt ein gesunder Lebensstil mit ausgewogener Ernährung, ausreichend Bewegung und Verzicht auf übermäßigen Alkoholkonsum zumindest vorbeugend auf sehr häufige Formen. Ist die Polyneuropathie die Folge einer Grunderkrankung, wie z. B. Diabetes mellitus, ist die konsequente Behandlung dieser Grunderkrankung entscheidend: „Menschen mit chronischen Erkrankungen sollten regelmäßige ärztliche Kontrollen wahrnehmen, um erste Anzeichen einer Polyneuropathie frühzeitig erkennen und behandeln zu können“, so der Ratschlag von Neurologen Krenn.
Fotos: zvg, istockphoto/ RyanKing999, feel image – Fotografie