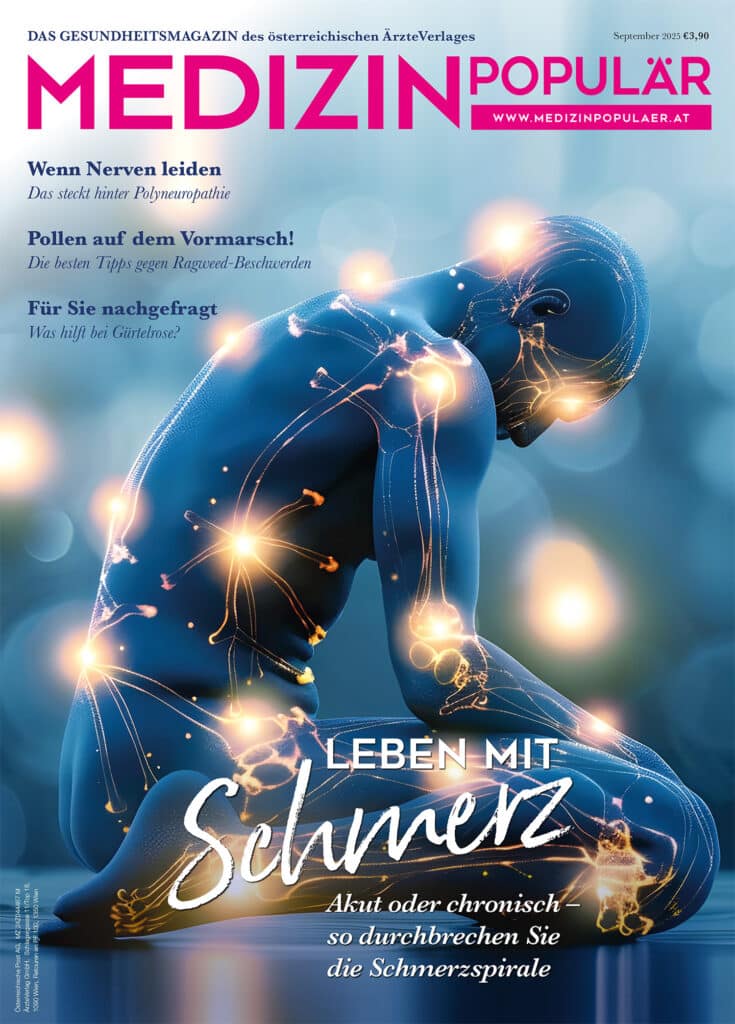Warum auch Tiere von Diabetes betroffen sein können und welche Therapieoptionen zur Verfügung stehen, erklärt Dr. Andrea Mergl, Tierärztin in der Kleintierpraxis Pöchlarn, Niederösterreich.

Diabetes bei Hund und Katze ist keine Seltenheit – und oft wird die Erkrankung erst bemerkt, wenn sie schon weit fortgeschritten ist. „Gerade Übergewicht und zunehmendes Alter erhöhen das Risiko“, erklärt Dr. Andrea Mergl. Wohnungskatzen – besonders Kater – sind häufiger betroffen, ebenso Tiere, die über längere Zeit Kortisonpräparate oder die „Katzenpille“ bekommen. Bei Hunden sind manche Rassen wie Retriever, Beagle oder Pudel anfälliger. Auch Entzündungen der Bauchspeicheldrüse (Pankreatitis) oder hormonelle Erkrankungen wie das Cushing-Syndrom können Diabetes auslösen.
Frühe Warnsignale erkennen
Vermehrter Durst, häufiges Urinieren und Gewichtsverlust trotz gesteigertem Appetit – diese Kombination sollte Tierhalter hellhörig machen. Bei Katzen kann sich später eine Schwäche entwickeln, die zu einem „hoppelnden“ Gang führt. Vor allem bei Hunden kann es durch die Schädigung der Augenlinse zu einem Grauen Star als Folge der Erkrankung kommen. „Die Diagnose funktioniert bei Hund und Katze gleich“, so Mergl. Im Harn lässt sich Zucker nachweisen, im Blut ist der Blutzuckerspiegel erhöht. Um sicherzugehen, wird zusätzlich der Langzeitzuckerwert (Fruktosamin) gemessen.
Typ 1 und Typ 2
Bei Hunden liegt meist ein Diabetes Typ 1 vor: Das Tier produziert kein Insulin mehr, oft durch eine Autoimmunreaktion. Bei Katzen dominiert der Typ 2, bei dem das vorhandene Insulin schlechter wirkt (Insulinresistenz). „Bei Katzen kann sich der Stoffwechsel erholen, wenn man schnell handelt – manchmal braucht es dann kein Insulin mehr. Allerdings kann es auch zu einem Rückfall kommen“, erklärt Mergl. Bei Hunden ist dagegen eine lebenslange Insulintherapie nötig. In der Regel wird Insulin zweimal täglich unter die Haut gespritzt. Seit Kurzem gibt es für Katzen auch ein flüssiges, einmal täglich zu verabreichendes orales Medikament – allerdings nur für sorgfältig ausgewählte Tiere.
Ernährung als Schlüssel
Diabetische Tiere sollten kohlenhydratarme, ballaststoffreiche Nahrung bekommen, um den Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Spezielles Diätfutter gibt es von verschiedenen Herstellern, doch auch selbst zubereitete Rationen sind möglich – wenn sie von Fachleuten berechnet werden. Wichtig sind feste Fütterungszeiten, damit Insulin und Nahrungsaufnahme zusammenpassen. „Wenn die Tiere nicht fressen und trotzdem Insulin gespritzt wird, können sie nämlich gefährlich unterzuckern“, betont Mergl. Zusätzlich zu Medikamenten und Ernährung sind auch Gewichtsoptimierung und ausreichend Bewegung wichtig.
Herausforderungen im Alltag
Die Behandlung von Tieren mit Diabetes erfordert Konsequenz: Spritzen setzen, Futter anpassen, Blutzucker kontrollieren und mögliche Komplikationen wie Ketoazidose oder Harnwegsinfekte im Blick behalten. Auch die Kosten für Medikamente, Diätfutter und Tierarztbesuche sind nicht zu unterschätzen. Die gute Nachricht: Mit rechtzeitiger Diagnose und Therapie können Hunde und Katzen mit Diabetes viele Jahre gut leben. Wichtig ist, dass die Tierhalterinnen und -halter das Trinkverhalten, den Appetit und Urinabsatz ihre Vierbeiner aufmerksam beobachten und regelmäßig zur Kontrolle in die Tierarztpraxis kommen. „So lassen sich Komplikationen früh erkennen und behandeln – und die Tiere können ihr Leben weitgehend beschwerdefrei genießen“, sagt Mergl.
Was steckt hinter der aktuellen Myxomatose-Welle bei Kaninchen?
Die „Kaninchenpest“ ist eine durch Pockenviren ausgelöste, für den Menschen harmlose, aber für Haus- und Wildkaninchen sowie Feldhasen meist tödliche Krankheit. Übertragen wird sie vor allem durch Stechmücken, Flöhe und Zecken, aber auch durch direkten Tierkontakt oder kontaminierte Gegenstände. Nach 3–9 Tagen treten Fieber, Schwellungen am Kopf, an den Genitalien und Gliedmaßen sowie Fressunlust auf. Eine Therapie gibt es nicht, meist verenden die erkrankten Tiere. Vorbeugung ist daher entscheidend: die jährliche Impfung (kombiniert mit Schutz gegen Rabbit Hamorrhagic Disease RHD), Quarantäne für Neuzugänge, Insektenschutz (Insektengitter, Repellentien) und Kontakt zwischen Haus- und Wildkaninchen vermeiden.
Fotos: brandstätter, istockphoto/Flashvector