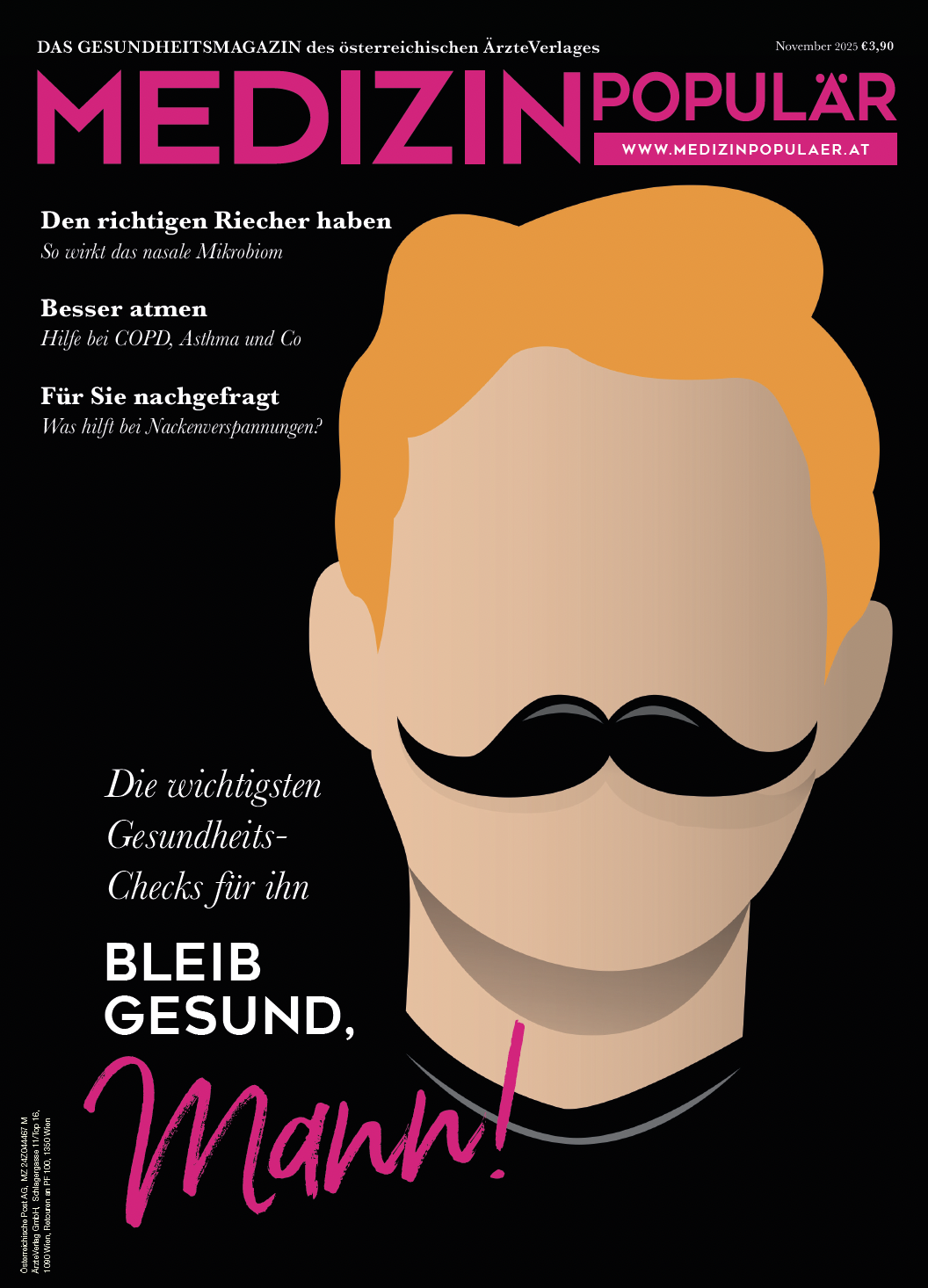Fettleber ist nicht nur beim Menschen ein Thema – auch Haustiere können betroffen sein. Auf welche Alarmzeichen es zu achten gilt und wie Tierhalterinnen und -halter vorbeugen können.

„Die Leber hat ein enormes Regenerationspotenzial. Wird rechtzeitig gehandelt, kann sie sich vollständig erholen.“
Die Leber ist ein mageres Organ – ihr Fettgehalt liegt normalerweise unter fünf Prozent“, erklärt Univ.-Prof. Dr. sc. agr. Qendrim Zebeli, Leiter des Zentrums für Tierernährung und Tierschutzwissenschaften an der Vetmeduni Wien. Lagert sich jedoch zu viel Fett ein, verändern sich die Leberzellen – sie verlieren ihre Funktionalität, können absterben und im schlimmsten Fall das gesamte Organ schädigen. „Ab etwa zehn Prozent Fettanteil sprechen wir von einer hochgradigen Leberverfettung“, erklärt der Experte. Bei Hunden kommt eine ernährungsbedingte Fettleber selten vor. Sie sind evolutionär daran gewöhnt, auch längere Zeit ohne Nahrung auszukommen. „Wenn Hunde eine Fettleber entwickeln, liegt fast immer eine andere Grunderkrankung vor – etwa ein schlecht eingestellter Diabetes mellitus, eine Entzündung des Darms, eine Vergiftung oder eine schwere Infektion.“ In diesen Fällen tritt die Leberverfettung also sekundär auf, als Folge einer bestehenden Störung.
Katzen häufiger betroffen
Bei Katzen ist die ernährungsbedingte Leberverfettung hingegen ein häufiges Krankheitsbild. Der Grund liegt in ihrer Biologie. „Katzen sind obligate Fleischfresser, deren Stoffwechsel stark auf Eiweiß angewiesen ist“, sagt Zebeli. „In der Natur fressen sie regelmäßig kleine Beutetiere – längere Hungerzeiten sind sie nicht gewohnt.“ Wenn eine Katze zwei oder mehr Tage nichts frisst, insbesondere wenn sie stark übergewichtig ist, werden Fettreserven aus dem Körper massiv mobilisiert, welche ihre Leber nur schlecht verstoffwechseln kann. „Diese Fette werden in der Leber abgelagert, was schnell zu einer Fettleber führen kann.“ Gründe für eine Nahrungsverweigerung gibt es viele: Appetitlosigkeit wegen einer anderen Erkrankung, Stress durch Veränderungen im Haushalt, ein neues Futter, Transport, Hitze oder der Verlust einer Bezugsperson. „Oft bemerkt der Tierhalter das erst spät – und nach zwei, drei Tagen ist der Schaden bereits entstanden.“
Warnsignale früh erkennen
Eine Fettleber entsteht meist schleichend. „Wenn eine Katze plötzlich teilnahmslos wird, weniger frisst oder sogar häufig erbricht und gelblich verfärbte Schleimhäute (Ikterus) zeigt, ist das bereits ein ernstes Warnsignal“, erklärt Zebeli. Daher gilt: „Eine Katze, die nicht frisst, sollte nach spätestens zwei Tagen tierärztlich untersucht werden.“
Diagnose und Therapie
Ihre Tierärztin oder Ihr Tierarzt stellt die Diagnose anhand der genannten Symptome und einer Untersuchung am Tier. Eine Ultraschalluntersuchung kann Veränderungen im Lebergewebe sichtbar machen, auch wenn im frühen Stadium die Diagnose manchmal schwierig ist. „Mit einer Blutuntersuchung kann man Leberenzyme und Bilirubin bestimmen. Sind diese Werte erhöht, besteht Verdacht auf eine Leberverfettung.“ Zur Bestätigung der Diagnose und ergänzend zur Blutuntersuchung führt die Tierärztin, der Tierarzt möglicherweise eine Feinnadelaspiration durch. Dabei wird eine sehr kleine Probe des Lebergewebes durch das Einführen einer feinen Nadel durch die Haut in die Leber entnommen. Der Goldstandard zur definitiven Diagnose wäre eine Biopsie, doch diese wird aufgrund der Belastung für das Tier nur in Ausnahmefällen durchgeführt und ist oft auch nicht nötig. Bei Katzen steht die sofortige Nahrungszufuhr im Vordergrund – meist als flüssige Nahrung über eine Sonde, da viele Tiere freiwillig nicht fressen. Wichtig ist dabei eine ausgewogene „Erholungsdiät“ mit allen notwendigen Nährstoffen inklusive sogenannter lipotroper Stoffe wie Methionin, Cholin, Vitamin B-Komplexe oder Taurin zu verabreichen. „Diese Substanzen helfen, Fette aus der Leber abzutransportieren.“ Manchmal sind auch weitere Unterstützungsmaßnahmen nötig, je nach Lage der erkrankten Katze. Für Tierhalterinnen und -halter ist Prävention entscheidend: „Übergewicht vermeiden, hochwertige Ernährung bieten und auf Veränderungen im Fressverhalten achten – das sind die besten Schutzmaßnahmen“, so Zebeli.
fotos: Michael Bernkopf/vetmeduni Wien, Istockphoto/ yayayoyo