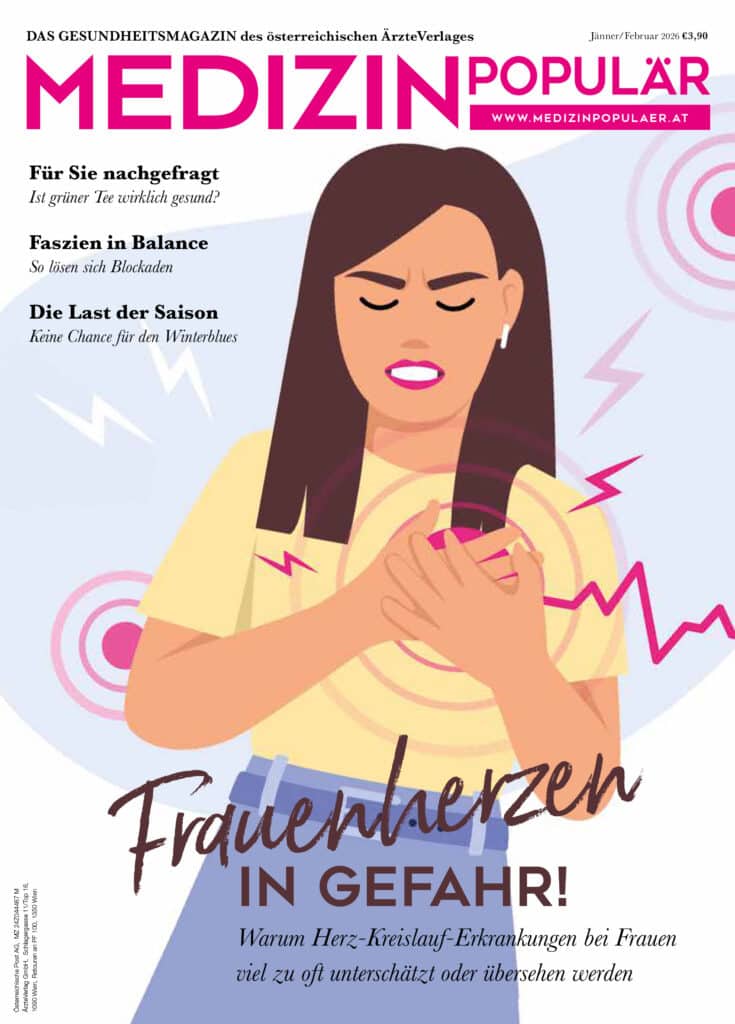Mit gezielten und individuell angepassten Übungen lassen sich viele chronische Erkrankungen positiv beeinflussen. Was Trainingstherapie vom Training im Fitnessstudio unterscheidet, wer sie anbieten darf und für wen sie geeignet ist.
Von Natascha Gazzari

„Trainingstherapie ist eine medizinische Therapie, die körperliches Training gezielt und individuell einsetzt.“
In der Rehabilitation und in Kurbetrieben ist Trainingstherapie seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des Therapiekonzepts. Seit 2025 kann diese hochwirksame Therapieform – deren Wirksamkeit bei mehr als 45 chronischen Erkrankungen wissenschaftlich belegt ist – auch über den Rehabereich hinaus im niedergelassenen Bereich in Anspruch genommen werden. Doch Trainingstherapie ist nicht mit einem klassischen Fitnessstudio-Training gleichzusetzen, wie Dr. Anita Birklbauer, Sportwissenschafterin und Trainingstherapeutin aus Elixhausen in Salzburg, erklärt: „Trainingstherapie ist eine medizinische Therapie, die körperliches Training gezielt und individuell einsetzt, um chronische Erkrankungen zu lindern, die körperliche Verfassung zu verbessern und im Idealfall sogar zu heilen.“
Wirksam von Krebs bis Depression
Die Anwendungsgebiete der Trainingstherapie gehen weit über den Bereich der orthopädischen Erkrankungen hinaus. Ihre Wirksamkeit ist bei einem Großteil der Herz-Kreislauf-, Stoffwechsel- und Krebserkrankungen sowie bei psychischen Erkrankungen umfangreich belegt. „Trainingstherapie ist bei fast allen nicht ansteckenden Krankheiten möglich und sinnvoll“, fasst Birklbauer zusammen.
Individuell und langfristig
Trainingstherapie wird von Sportwissenschafterinnen und Sportwissenschaftern, die nach durchlaufenem Akkreditierungsprozess durch das Bundesministerium für Gesundheit als „Trainingstherapeutinnen und Trainingstherapeuten“ bezeichnet werden, angeboten und durch Zuweisung eines Arztes oder einer Ärztin entsprechend verordnet. Mit klassischem Training hat Sporttherapie wenig zu tun: Jede Therapie wird individuell auf die spezifischen Bedürfnisse, Fähigkeiten und Einschränkungen angepasst. „Viele Menschen leiden an mehreren Erkrankungen, wie Rückenschmerzen und Bluthochdruck. Die Trainingstherapie kann beide Bereiche gleichzeitig positiv unterstützen.“ Die Übungen berücksichtigen den aktuellen Genesungsfortschritt, die damit verbundenen körperlichen Voraussetzungen und die Funktionalität. „Wichtig ist, dass vor Beginn des Trainings eine trainingstherapeutische Diagnostik erfolgt, um patientengerecht in die Therapie zu starten. Durch Verlaufsanalysen werden Inhalte und Intensitäten angepasst – das ist wesentlich für den Erfolg der Therapie“, ergänzt Birklbauer. Regelmäßigkeit und Langfristigkeit sind – wie bei jeder Bewegungstherapie – auch hier der Schlüssel zum Erfolg.
So wirkt Trainingstherapie
Orthopädische Erkrankungen:
- Rückenschmerzen: Stärkung der Rumpfmuskulatur,
Verbesserung der Körperhaltung - Arthrose: Mobilisierung und Stabilisierung der Gelenke
- Bandscheibenvorfall: Muskelaufbau zur Entlastung der Wirbelsäule
- Osteoporose: Förderung der Knochendichte durch gezielte
Belastung
Neurologische Erkrankungen:
- Multiple Sklerose (MS): Verbesserung von Beweglichkeit und
Muskelkraft - Morbus Parkinson: Förderung von Koordination und Gleichgewicht
- Schlaganfall: Wiederherstellung motorischer Fähigkeiten und
Muskelstärkung
Herz-Kreislauf-Erkrankungen:
- Koronare Herzkrankheit: Verbesserung der Herzleistung und der allgemeinen Ausdauer
- Bluthochdruck: Regulierung des Blutdrucks durch aerobes Training
- Rehabilitation nach Herzinfarkt: sicheres Wiedereinstiegstraining für das Herz-Kreislauf-System
Stoffwechselerkrankungen:
- Diabetes mellitus: Verbesserung der Insulinempfindlichkeit und
Blutzuckerkontrolle - Adipositas: Förderung des Kalorienverbrauchs und des Stoffwechsels
Psychische und psychosomatische Erkrankungen:
- Depressionen: Förderung der Ausschüttung von Endorphinen,
Verbesserung des Wohlbefindens - Burnout: Abbau von Stress durch kontrollierte körperliche Aktivität
Onkologische Erkrankungen:
- positive Beeinflussung der Leistungsfähigkeit
- Reduktion therapie- und krankheitsbedingter Folgewirkungen
- Verbesserung der Schlafqualität und des Selbstbewusstseins
Fotos: ZVG, istockphoto/Sean Anthony Eddy