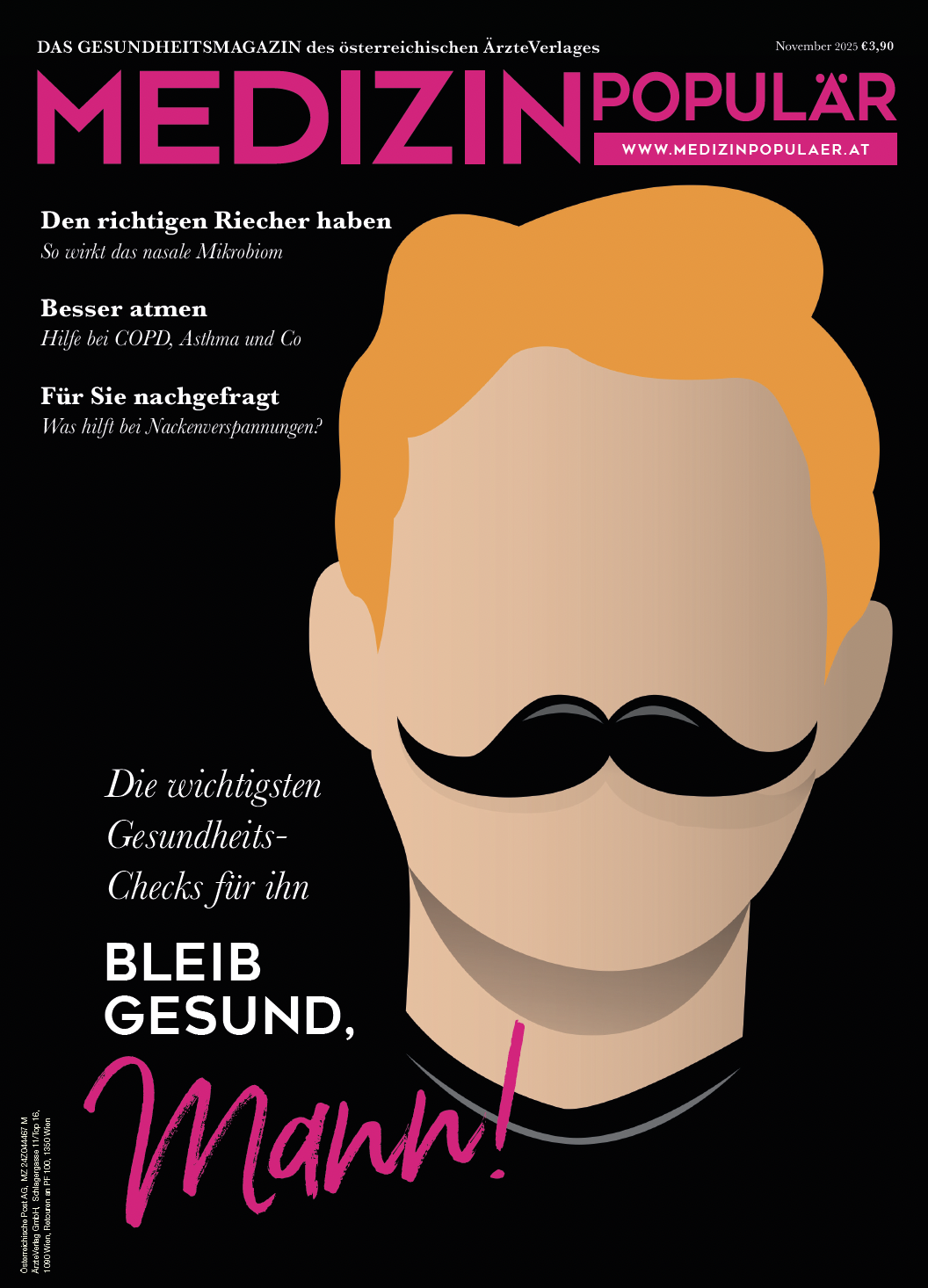Wie eine Allergie gegen Hausstaubmilben diagnostiziert wird, welche Therapien langfristig helfen und mit welchen einfachen Maßnahmen Sie es den winzigen Spinnentierchen in Ihrem Zuhause so richtig ungemütlich machen.
Von Natascha Gazzari

Bruckner-Kröll
„Eine behinderte Nasenatmung ist das Hauptsymptom einer Hausstaubmilbenallergie.“
Sie wachen morgens mit verstopfter Nase, Niesattacken und juckenden Augen auf? – Nicht immer sind es Erkältungsviren, die hinter Beschwerden wie diesen stecken. Werden die Tage kühler, verbringen wir mehr Zeit in den eigenen vier Wänden und sorgt die Heizung für mollige Wärme, haben für das menschliche Auge unsichtbare Mitbewohner Hochsaison. Die Rede ist von mikroskopisch kleinen Spinnentieren. Ihr wissenschaftlicher Name „Dermatophagoides“ bedeutet „Hautfresser“ und das trifft es recht gut, denn Hausstaubmilben ernähren sich vorwiegend von abgefallenen Hautschuppen. Hausstaubmilben fühlen sich überall dort besonders wohl, wo es kuschelig warm und ausreichend feucht ist. Matratzen, Kissen, Kuscheltiere, Sofas und Teppiche sind für die Spinnentiere der Himmel auf Erden. Für Personen, die auf den Kot der Milben und auf Bestandteile ihres Panzers allergisch reagieren, kann das eigene Bett zur Gefahrenzone werden, in der an erholsamen Schlaf kaum mehr zu denken ist.
Alarm im Immunsystem
Kommen sensibilisierte Menschen mit dem Milbenkot und Milbenbestandteilen in Kontakt, reagiert das Immunsystem auf darin enthaltene Eiweiße und setzt den Botenstoff Histamin frei. Die Folge dieser überschießenden Immunantwort auf die harmlosen Milbenbestandteile führt zu Entzündungsreaktionen im Bereich der Nase, der Augen, der Lunge und teilweise auch der Haut. Eine verstopfte oder rinnende Nase, Niesattacken – besonders am Morgen – sowie tränende und juckende Augen zählen zu den typischen Symptomen einer Hausstaubmilbenallergie. „Aus meiner Sicht als HNO-Ärztin ist die behinderte Nasenatmung das Hauptsymptom einer Hausstaubmilbenallergie“, berichtet OÄ Dr. Sabina Bruckner-Kröll, Leiterin der Allergieambulanz im Bezirkskrankenhaus Kufstein.
Allergie oder banaler Infekt?
Nach der Pollenallergie ist die Hausstaubmilbenallergie die zweithäufigste Allergie im Lande: „Viele Betroffene wissen allerdings gar nicht, dass hinter ihren Beschwerden eine Allergie steckt. Für Laien ist die Hausstaubmilbenallergie nämlich nicht einfach zu erkennen“, weiß die Allergieexpertin. Gerade in der kühlen Jahreszeit, wenn sich die Hausstaubmilben durch die warme Heizungsluft besonders gut vermehren, haben auch virale Infekte Hochsaison. Ist die Nase in der Früh verstopft, rinnt sie oder kommt es zu Niesanfällen, könnte auch eine banale Erkältung die Ursache sein. Bekommen Kinder in der Nacht durch die Nase schwer Luft und schnarchen sie, könnte es auch an vergrößerten Rachenmandeln liegen.
Es gibt jedoch einige Kriterien, die dabei helfen können, eine Allergie von einer Erkältung abzugrenzen: „Ein Infekt ist akut, fängt rasch an und vergeht in den meisten Fällen nach einigen Tagen von selbst wieder. Oft sind mehrere Familienmitglieder davon betroffen und das allgemeine Wohlbefinden ist eingeschränkt. Die Allergie hingegen ist chronisch, die Beschwerden kommen immer wieder und verstärken sich in der kalten Jahreszeit“, erklärt die HNO-Ärztin. Zur besseren Einordung der Symptome hilft auch ein Blick auf die Familiengeschichte. „Die Milbenallergie ist meist nicht die erste Allergie, die sich zeigt. Häufig haben Betroffene bereits andere Allergien, wie eine Pollenallergie, bevor sich die Hausstaubmilbenallergie entwickelt“, ergänzt Bruckner-Kröll.
Allergie identifizieren
Wer die Nase im wahrsten Sinn des Wortes jeden Morgen „voll“ hat, sollte den Beschwerden auf den Grund gehen. Bleibt eine Hausstaubmilbenallergie unentdeckt und somit unbehandelt, können die allergischen Beschwerden von Auge und Nase weiter in Richtung Lunge wandern und in weiterer Folge zu Asthma bronchiale führen. „Wer eine Allergie vermutet, sollte sich an die Hausärztin oder den Hausarzt wenden. Schon hier kann oftmals eine erste Verdachtsdiagnose erfolgen und eine Überweisung zu ergänzenden Allergietests ausgesprochen werden“, so die Medizinerin. Allergietestungen werden von allergologisch geschulten Allgemeinärztinnen und -ärzten oder Fachärztinnen und -ärzten für Kinder-, Haut-, Lungen- oder HNO-Krankheiten sowie in speziellen Allergie-Ambulatorien durchgeführt. Nach einem ausführlichen Gespräch und einer körperlichen Untersuchung zählt der „Pricktest“ zu den Standardverfahren der Allergiediagnostik. Dabei werden kleine Tropfen mit den Allergenen der Hausstaubmilbe auf die Haut aufgetragen und dann mit Hilfe einer Lanzette in die Haut eingebracht. Kommt es innerhalb von 20 Minuten an der Hautstelle zu Rötungen, Juckreiz und Quaddeln, liegt die Diagnose Hausstaubmilbenallergie nahe. „Ergänzend zum Hauttest kann eine Blutuntersuchung durchgeführt werden, um das Gesamt-IgE und spezifische IgE-Antikörper gegen Hausstaubmilben-Allergene zu bestimmen.“ Ein weiterer möglicher Baustein der Diagnostik ist der sogenannte Provokationstest, bei dem das verdächtige Allergen direkt auf die Nasenschleimhaut aufgebracht wird.
Wieder frei durchatmen
Wer allergisch auf bestimmte Stoffe reagiert, sollte den Kontakt zu diesen Stoffen möglichst meiden. Klingt einfach, kann sich im Fall von Hausstaubmilben jedoch schwierig gestalten, denn die winzigen Spinnentiere leben in jedem auch noch so sauberen Haushalt. Es lohnt sich dennoch, ihnen das Leben so schwer wie möglich zu machen und die Allergenbelastung in den Wohnräumen zu reduzieren. „Allergendichte Überzüge bei der Matratze – sogenannte Encasings – und ein Staubsauger mit HEPA-Filter sind die wichtigsten Maßnahmen zur Allergenvermeidung“, so Bruckner-Kröll. Ideal ist es, wenn auch Polster und Bettdecke mit Encasings ausgestattet werden. Alternativ kann das Bettzeug regelmäßig gewaschen werden und zwar mit mindestens 60 Grad, da die Milben und deren Allergene erst bei hohen Waschtemperaturen vernichtet werden. „Kuscheltiere, die nicht bei hohen Temperaturen gewaschen werden können, sollten in einem verschlossenen Plastikbeutel für mindestens 24 Stunden ins Gefrierfach gelegt werden“, so die Empfehlung der Ärztin. Generell gilt: Oberflächen und Gegenstände bevorzugen, die man regelmäßig abwischen oder bei hohen Temperaturen waschen kann. So gut es geht sollte auf Teppiche, Vorhänge und stoffbezogene Möbel verzichtet werden und pflegeleichte Materialien gewählt werden. Heizkörper sollten regelmäßig, besonders vor Beginn der Heizperiode, gereinigt werden, da sich in ihnen besonders viel Staub sammeln kann, der dann in den Räumen verteilt wird. Von diversen Sprays und Lösungen, die Teppiche, Kuscheltiere und Polstermöbel milbenfrei machen sollen, rät die Allergologin eher ab: „Wer bereits an Allergien leidet, sollte mit dem Sprühen von Chemikalien in den Wohnräumen zurückhaltend sein.“
Symptome lindern, Immunsystem trainieren
Reichen die oben beschriebenen Maßnahmen nicht aus, um die allergischen Beschwerden in den Griff zu bekommen, können diverse Medikamente zur Symptomlinderung eingesetzt werden. „Abhilfe schaffen etwa Nasenspülungen mit Kochsalzlösung, Nasensprays mit Cortison oder Antihistaminika in Tablettenform. Hat sich bereits Asthma entwickelt, muss auch das entsprechend therapiert werden“, erklärt Bruckner-Kröll. Antihistaminika & Co können die Symptome zwar kurzzeitig in Schach halten, setzen jedoch nicht an der Ursache der Allergie an. Langfristig hilft nur die sogenannte Hyposensibilisierung, auch bekannt als „Allergie-Impfung“. Sie ist die einzige Therapieform, die sowohl die Beschwerden als auch die Ursache der Allergie bekämpft. Die Hyposensibilisierung steht in Form von Injektionen, Tropfen und Tabletten zur Verfügung und unterstützt das Immunsystem dabei, sich schrittweise an die Allergene zu gewöhnen. Wer sich für eine Immuntherapie entscheidet, braucht Geduld, wie die Allergologin weiß: „Die Therapie dauert mindestens drei Jahre, wobei man nach einem Jahr bereits eine deutliche Verbesserung der Beschwerden spüren sollte.“ Die Behandlung ist bereits für Kinder ab fünf Jahren zugelassen, sehr wirksam und gut verträglich. „Gerade zu Beginn der Behandlung kann es zu Nebenwirkungen wie Jucken und Brennen im Mund kommen. In diesem Fall können die unerwünschten Effekte mit
verschiedenen Maßnahmen behandelt werden. Durchhalten zahlt sich auf jeden Fall aus!“
So ticken Hausstaubmilben
Was Milben lieben:
- warme Temperaturen über 22 Grad Celsius
- eine relative Luftfeuchte von 50 Prozent oder mehr
- alles was kuschelig, fellig und flauschig ist
- Matratzen, Polster, Decken, Teppiche und Vorhänge
- Waschen mit niedrigen Temperaturen unter 60 Grad Celsius
- die Rillen von Heizkörpern
Was Milben nicht mögen:
- glatte, wischbare Böden und Oberflächen
- kühle Schlafräume mit weniger als 50 Prozent Luftfeuchtigkeit
- Ledersofas
- Wasserbetten (weil sie keine Matratze haben)
- Waschprogramme mit 60 Grad und mehr
- tiefe Temperaturen (Gefrierschrank)
- allergendichte Überzüge (Encasings)
- Staubsauger mit hocheffizienten HEPA-Filtern
Fotos: zvg, istockphoto/nopparit